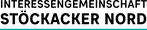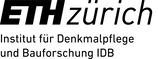Abbruch einer intakten Siedlung – weshalb?
Viele Baufachleute fragen sich: Weshalb fasst die FAMBAU den Abriss der Meienegg überhaupt ins Auge? Weshalb nimmt sie als gemeinnützige Institution einen solch immensen Verlust an günstigen Wohnungen für diejenigen in Kauf, die ihn am dringendsten benötigen?
Die FAMBAU verfolgt vordergründig das Ziel, «kinderreichen Familien angenehmen Wohnraum zu möglichst günstigen Mietzinsen» zu bieten. Weshalb sollte dieses Ziel nicht auch mit der Instandstellung oder Sanierung der bestehenden Siedlung erreicht werden können? Die mehrfache Behauptung der FAMBAU, dass die Häuser nicht mehr sanierbar seien, entbehrt dabei jeglicher fundierten Analyse; noch wurden keinerlei bauphysikalische oder statische Untersuchungen durchgeführt. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass es ihr zumindest ebenso um die Gewinnmaximierung durch eine höhere Ausnützung ihres Grundstücks geht. Dafür sprechen zwei Faktoren:
Die FAMBAU verfolgt vordergründig das Ziel, «kinderreichen Familien angenehmen Wohnraum zu möglichst günstigen Mietzinsen» zu bieten. Weshalb sollte dieses Ziel nicht auch mit der Instandstellung oder Sanierung der bestehenden Siedlung erreicht werden können? Die mehrfache Behauptung der FAMBAU, dass die Häuser nicht mehr sanierbar seien, entbehrt dabei jeglicher fundierten Analyse; noch wurden keinerlei bauphysikalische oder statische Untersuchungen durchgeführt. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass es ihr zumindest ebenso um die Gewinnmaximierung durch eine höhere Ausnützung ihres Grundstücks geht. Dafür sprechen zwei Faktoren:
1. Dass Siedlung baufällig ist, ist anzuzweifeln.
Die Häuser befinden sich, sowohl was das Äussere wie auch das Innere und ihre Umgebung betrifft, in einem für Bauten der 1950er-Jahre aussergewöhnlich guten Erhaltungszustand. Der grosse Anteil an noch im Originalzustand vorhandenen Bauteilen und Ausstattungselementen ist für Siedlungen aus dieser Epoche sehr selten (Abb. 10). Wie verschiedene andere Beispiele von jüngst renovierten Wohnsiedlungen der Nachkriegszeit zeigen, wäre eine energetische Ertüchtigung bzw. eine Sanierung durchaus möglich, sofern denn ein Interesse am Erhalt dieses einzigartigen Geschichtszeugen bestünde. Anbieten würde sich z. B. eine gezielte Nachisolation (Dachboden, Keller, Fenster) oder die Umstellung auf neue Formen der Energiegewinnung, schliesslich wurde in der Meienegg von Beginn an eine Fernheizanlage installiert. Als leuchtendes Vorbild für den sorgsamen Umgang mit einer Siedlung der Nachkriegszeit könnte dabei die – ebenfalls denkmalgeschützte – Überbauung Grabenacker in Winterthur dienen: Im Rahmen des 2022 abgeschlossenen Sanierungsprojekts war es den Bauherrschaften sogar möglich, den einen oder anderen Neubau am Rand der Siedlung zu realisieren; im Gegenzug wurden die restlichen Häuser, im gegenseitigen Einvernehmen, unter Schutz gestellt und für sie ein verbindliches Sanierungskonzept festgeschrieben.
Die Häuser befinden sich, sowohl was das Äussere wie auch das Innere und ihre Umgebung betrifft, in einem für Bauten der 1950er-Jahre aussergewöhnlich guten Erhaltungszustand. Der grosse Anteil an noch im Originalzustand vorhandenen Bauteilen und Ausstattungselementen ist für Siedlungen aus dieser Epoche sehr selten (Abb. 10). Wie verschiedene andere Beispiele von jüngst renovierten Wohnsiedlungen der Nachkriegszeit zeigen, wäre eine energetische Ertüchtigung bzw. eine Sanierung durchaus möglich, sofern denn ein Interesse am Erhalt dieses einzigartigen Geschichtszeugen bestünde. Anbieten würde sich z. B. eine gezielte Nachisolation (Dachboden, Keller, Fenster) oder die Umstellung auf neue Formen der Energiegewinnung, schliesslich wurde in der Meienegg von Beginn an eine Fernheizanlage installiert. Als leuchtendes Vorbild für den sorgsamen Umgang mit einer Siedlung der Nachkriegszeit könnte dabei die – ebenfalls denkmalgeschützte – Überbauung Grabenacker in Winterthur dienen: Im Rahmen des 2022 abgeschlossenen Sanierungsprojekts war es den Bauherrschaften sogar möglich, den einen oder anderen Neubau am Rand der Siedlung zu realisieren; im Gegenzug wurden die restlichen Häuser, im gegenseitigen Einvernehmen, unter Schutz gestellt und für sie ein verbindliches Sanierungskonzept festgeschrieben.
2. Die FAMBAU verlangt Marktmieten.
Die FAMBAU hat in Niederwangen im Neubauquartier Ried zusammen mit der Pensionskasse der Gemeinde Köniz die Neuüberbauung «Eisvogel» erstellt. Die Überbauung umfasst zwei Doppelmehrfamilienhäuser, eine grosse gemeinsame Einstellhalle und den Pavillon des Gemeinschaftsraums. Die Wohnungen beider Bauherrschaften sind ähnlich hinsichtlich der Grundrisse, des Komforts und der Ausstattung, die Mietkonditionen unterscheiden sich kaum. Die Bruttomiete für eine Dreieinhalbzimmerwohnung mit 87 m2 der FAMBAU kostet Fr. 1'591.00, bei der Pensionskasse kostet derselbe Wohnungstyp mit 94 m2 Fr. 1'656.00. Für eine der Viereinhalbzimmerwohnungen verlangt die FAMBAU Fr. 1'958.00 (108 m2), die Pensionskasse Fr. 1'949.00 (116 m2). Fazit: Obwohl die Pensionskasse aus dem Ertrag der Liegenschaften die Renten ihrer Versicherten bezahlen muss, die FAMBAU gemäss Eigendarstellung demgegenüber nicht gewinnorientiert ist, sind die Mietkonditionen vergleichbar und liegen auf dem Niveau profitorientierter Marktmieten. Es ist deshalb beim Neubauprojekt in der Meienegg davon auszugehen, dass die FAMBAU Marktmieten festlegen wird, die für eine Dreieinhalbzimmerwohnung mindestens Fr. 1'700.00 und für eine Viereinhalbzimmerwohnung mindestens Fr. 2'000.00 betragen werden.
Die FAMBAU hat in Niederwangen im Neubauquartier Ried zusammen mit der Pensionskasse der Gemeinde Köniz die Neuüberbauung «Eisvogel» erstellt. Die Überbauung umfasst zwei Doppelmehrfamilienhäuser, eine grosse gemeinsame Einstellhalle und den Pavillon des Gemeinschaftsraums. Die Wohnungen beider Bauherrschaften sind ähnlich hinsichtlich der Grundrisse, des Komforts und der Ausstattung, die Mietkonditionen unterscheiden sich kaum. Die Bruttomiete für eine Dreieinhalbzimmerwohnung mit 87 m2 der FAMBAU kostet Fr. 1'591.00, bei der Pensionskasse kostet derselbe Wohnungstyp mit 94 m2 Fr. 1'656.00. Für eine der Viereinhalbzimmerwohnungen verlangt die FAMBAU Fr. 1'958.00 (108 m2), die Pensionskasse Fr. 1'949.00 (116 m2). Fazit: Obwohl die Pensionskasse aus dem Ertrag der Liegenschaften die Renten ihrer Versicherten bezahlen muss, die FAMBAU gemäss Eigendarstellung demgegenüber nicht gewinnorientiert ist, sind die Mietkonditionen vergleichbar und liegen auf dem Niveau profitorientierter Marktmieten. Es ist deshalb beim Neubauprojekt in der Meienegg davon auszugehen, dass die FAMBAU Marktmieten festlegen wird, die für eine Dreieinhalbzimmerwohnung mindestens Fr. 1'700.00 und für eine Viereinhalbzimmerwohnung mindestens Fr. 2'000.00 betragen werden.
Abriss und Neubau heizen den Klimawandel weiter an
Nicht ausser Acht zu lassen sind auch die ökologischen Folgen eines Abrisses. Die Bauwirtschaft zeichnet für über 80% des Schweizer Abfallvolumens verantwortlich. Vier Millionen Tonnen Bauabfall fallen alleine durch Abbrucharbeiten an. Nicht zuletzt deshalb rückte das Thema «Graue Energie» in den letzten Jahren vermehrt auch in den Fokus der Baukultur. Auch der 2021 vom Klimastreik Schweiz unter Beizug von renommierten Expertinnen und Wissenschaftlern veröffentlichte, interdisziplinäre Massnahmenplan, der Klimaaktionsplan (CAP), legt einen Hauptfokus auf baukulturelle Themen: Die erste geforderte Massnahme zur Reduktion des von der Bauwirtschaft verursachten CO2-Austosses ist ein sofortiges Moratorium für neue Gebäude und Strassen bis 2030. Doch nicht nur Klimaaktivistinnen und Akademiker setzen sich aus Nachhaltigkeitsgründen gegen Abbrüche und für Sanierungen ein, auch die Leitorganisation im schweizerischen Bauwesen, der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA), erklärt, «dass eine Ersatzneubaustrategie keine Klimaschutzstrategie ist. Die Lebensdauerverlängerung von Gebäuden ist eine Klimaschutzstrategie.» Angesichts des fortschreitenden Klimawandels und der breit geführten Diskussion um unseren Umgang mit endlichen Ressourcen erstaunt es, dass die Themen Nachhaltigkeit, Graue Energie usw. in den bislang zum Ersatzneubau der Meienegg veröffentlichten Dokumenten, im Architekturwettbewerb und in den Medien «totgeschwiegen» wurden.
Die Meienegg, ein Werk von Gret Reinhard
Obwohl auf den Plänen nicht schriftlich vermerkt, kann gemäss verschiedenen mündlichen Quellen davon ausgegangen werden, dass der Entwurf der Meienegg – offiziell ein Werk des Architekturbüros Hans und Gret Reinhard – hauptsächlich aus der Feder von Gret Reinhard stammt. Neben der «oral history» sprechen auch die Umstände für diese These, dass Hans Reinhard zur Zeit der Planung der Siedlung bereits mehrere politische Ämter besetzte, Aktivdienst leistete und erst später, beim Bau der Grossiedlungen im Tscharnergut oder im Schwabgut/Gäbelbach eine tragende Rolle im gemeinsamen Architekturbüro übernahm. Die junge Architektin Gret Reinhard war ihrerzeit eine der ersten Frauen im «Bund Schweizer Architekten» (BSA), und die Meienegg wäre, sollte sich die Hypothese bestätigen, eine der ersten von einer Architektin entworfenen Mehrfamilienhaussiedlungen der Schweiz. Aktuell beschäftigt sich ein SNF-Forschungsprojekt an der ZHAW eingehend mit dieser Fragestellung.